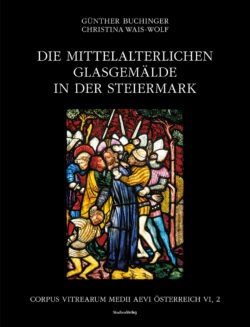Einzelheft StudentInnen (Bestellung mit Beilegung einer Inskriptionsbestätigung): Euro 14,40
Beiträge
Barbara Staudinger
Juden als „Pariavolk“ oder „Randgruppe“? Bemerkungen zu Darstellungsmodellen des christlich-jüdischen Verhältnisses in der Frühen Neuzeit
Barbara Krug-Richter
Von Messern, Mänteln und Männlichkeit. Aspekte studentischer Konfliktkultur im frühneuzeitlichen Freiburg im Breisgau
Peter Becker
Der Verbrecher zwischen Dämonisierung und Normalisierung. Überlegungen zur Kriminologie des 19. Jahrhunderts
Margarete Grandner
Regelungen des Gesundheitswesens in Österreich im 19. Jahrhundert
Forum
Gudrun Hopf/Angelika Klampfl/Margareth Lanzinger
Was heißt schon „normal“? Facetten eines Forschungsprojektes
Achim Landwehr
Normen als Praxis und Kultur. Policeyordnungen in der Frühen Neuzeit
Anton Tantner
Zur Unordnung der Häuser. Eine heterotopologische Miszelle
Birgitta Bader-Zaar
Grundrechte in der historischen Immigrationsforschung. Das Beispiel chinesischer und japanischer Einwanderer in den Vereinigten Staaten im „langen“ 19. Jahrhundert
Heidemarie Markhardt
„Sprachnormierung“ in der Europäischen Union. Die Entstehung von spezifischen Varietäten der EU-Amtssprachen
Hefteditorial
„Paradeiser“ oder „Tomate“, legal oder illegal, normkonform? Zu Normen und Normalitätsvorstellungen
Sichtbare und unsichtbare Normen, ihre Aneignung und Umsetzung bestimmen unser Leben in entscheidendem Maß. Beide Ebenen, Norm und Praxis, sind dabei nicht als einseitiger Wirkzusammenhang zu denken, sondern als vielfältig miteinander verflochten. „Normierte Lebenswelten“, der Titel des Heftes, führt die Alltags-Dimension ein und verweist auf ein breites Spektrum an Bereichen, in denen Normen und Vorstellungen von Normalität entstehen und zum Tragen kommen.
Die Einschätzung st grundsätzlich von Ambivalenz gekennzeichnet: Positiv formuliert „ordnen und informieren“ Normen, sie „schaffen Transparenz und reduzieren Komplexität, erlauben die Zurechnung von Normerfüllung und Abweichung“. Sie geben Sicherheit und stellen ein Instrumentarium bereit, um gesellschaftspolitisch relevante Ziele in ihrer Realisierung zu unterstützen. Doch verbinden sich mit Normen und Normierung auch deutlich negative Assoziationen – beides symbolisiert durch den Schraubstock auf dem Titelbild: Der Schraubstock ermöglicht bestimmte Arbeitsgänge, indem er Objekte fixiert; gleichzeitig schränkt er dadurch ihre Bewegbarkeit ein, erlaubt keine Abweichungen, schafft unverrückbare Tatsachen – übertragbar auf den von Michel Foucault geprägten Begriff der „Normalisierungsgesellschaft“, deren Kehrseite sozialer Ausschluss ist. Der Schraubstock repräsentiert – baukastenartig in seine Einzelteile zerlegbar – zugleich auch den Prozess der technischen Normierung und Standardisierung, getragen von Konzepten der Rationalisierung, Austauschbarkeit und Kompatibilität.
Wortgeschichtlich geht der Begriff „Norm“, aus dem Lateinischen „norma“ abgeleitet, auf die Bautechnik zurück, genauer auf das Winkelmaß. Doch hatte der Terminus auch schon in der Antike die bis heute bestimmende Grundbedeutung von „Richtschnur“ im Sinne von „Regel“ einerseits und „Maßstab“ andererseits. In diese zwei Bereiche lassen sich Normen generell, wenn auch nur grob unterteilen: Norm als Regel im Sinn von Vorschrift, Disziplinierung, moralischer oder rechtlich-gesetzlicher Handlungsanleitung und Norm als Maß im Sinne von Normalität, als technisch-pragmatischer Standard in Form der DIN- bzw. Ö?Normen oder als empirisch ermittelter Durchschnitt. Freilich gibt es auch Überschneidungen zwischen diesen beiden Bereichen, insbesondere dort, wo es um Nichteinhaltung von Normen geht – „deviantes“ Verhalten etwa lässt sich in beide Richtungen interpretieren. Ein anschauliches Beispiel für das Aufkommen standardisierter Maßstäbe ist die im Laufe der Frühen Neuzeit gewachsene Vorstellung, dass die Tauglichkeit eines Soldaten vornehmlich an seiner Körpergröße abzulesen sei. Diese wirkte in weiterer Folge auf die Herausbildung von militärischen Rekrutierungsnormen zurück – das Ineinandergreifen verschiedener Normvorstellungen wird hier exemplarisch veranschaulicht.
Während sich Reglementierungen in schriftlich fixierter Form – wie Kleider-, Bau- oder Policeyordnungen, Weistümer, Stadt-, Dorf- oder Bürgerordnungen, Gesetze, Erlässe und Statuten usw. – während der ganzen Neuzeit finden, ist die Erstellung offizialisierter Maßstäbe von Normalität und Standards ein jüngeres Phänomen. Erst die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelnde Sozialstatistik erarbeitete auf Basis serieller Daten – Stichwort: Verdatung – derartige Vorstellungen mit dem Anspruch einer allgemeineren Gültigkeit. Erfasst wurden nahezu alle Lebensbereiche; eine führende Rolle kam insbesondere der Anthropologie und der Medizin zu. Scheinbar widersprüchliche Wahrnehmungen gab es auch hier: Statistische Erhebungen ließen als solche klassifizierte „Abweichungen“ von der Norm wie Verbrechen, zwerghaften Wuchs, geistige Behinderung oder Selbstmord zwar als Extremformen erscheinen, wiesen ihnen gleichzeitig – gemessen an der Häufigkeit ihres Auftretens – aber auch eine gewisse Regelmäßigkeit und damit wiederum „Normalität“ zu. Weiters konstituierte sich das Selbstbild des bürgerlichen Menschen im 19. Jahrhundert, wie Peter Becker in seinem Beitrag eindrucksvoll belegt, wesentlich durch die Konstruktion eines anders gearteten „Verbrechermenschen“. Vor dessen Folie erfolgte die Selbstvergewisserung der bürgerlichen Gesellschaft; wechselnde Konzepte von Ausschluss und Integration des „Anderen“ begleiteten die entsprechenden Debatten.
Das Bestreben nach Standardisierung beschränkt sich nicht nur auf statistische oder technische Normen – letztere thematisiert Günter Dinhobl in diesem Heft mit der „neu gelesenen“ Kulturgeschichte der Schraube -, sondern geht hin bis zu normierter Sprachverwendung. Am Beispiel des aktuellen EU-Kontextes legt Heidemarie Markhardt Ziele wie Komplikationen der sprachlichen Normierungs- und Vereinheitlichungsverfahren dar: Das Gewährleisten von Eindeutigkeit in der amtlichen EU-Kommunikation steht – wie die immer wieder aufflammenden Diskussionen und medialen Empörungen zeigen – den Erhaltungsansprüchen nationalsprachlicher Varianten als offensichtlichen Trägern von Identitäten gegenüber.
Jener Teil des Normen-Spektrums, der auf das Verhalten abzielt, ist dem Bereich der sozialen Normen zuzurechnen. Ihre Bandbreite umfasst mündliche Tradition wie verschriftlichtes Recht und erstreckt sich von Formen des zwischenmenschlichen Umgangs – auf Basis von Benimmbüchern wie dem „Knigge“, von einschlägiger Sozialisation oder implizitem tacit knowledge – bis hin zur „Genfer Konvention“. Ob eine Unterscheidung zwischen Rechtsnormen und anderen ausgesprochenen und unausgesprochenen sozialen Normen Sinn macht, hängt vom jeweiligen Kontext ab. Konstitutiv ist ihre kollektive Verbindlichkeit und in weiterer Folge ihre Sanktionierbarkeit – wenn auch lange nicht jeder Regelverstoß tatsächlich geahndet wird. Denn die sozialen Normen einer Gesellschaft sind nie vollständig konsistent, sondern lückenhaft und uneindeutig, und die Tatsache, dass „zwischen Regelsystemen und Sanktionen Inkohärenzen bestehen“, wird von den Handelnden auch bewusst genutzt.
Mehrdimensional sind die normativen Texte selbst wie auch deren Wirkungsgeschichte zu sehen. Die spröden und bei erster Lesung nicht immer verständlichen Gesetze der Frühen Neuzeit, die häufig nicht eingehalten wurden und auch nur begrenzt durchsetzbar waren, besaßen einen doppelten, einen pädagogischen Boden: Dem Gesetzgeber ging es dabei, wie Achim Landwehr in seinem Beitrag verdeutlicht, nicht so sehr um Sanktionierung, sondern vor allem darum, die Inhalte der Normen allmählich, d.h. durch stetiges Wiederholen, in die Lebenswelt der Untertanen zu implementieren. Am Beispiel des österreichischen Reichssanitätsgesetzes von 1870, das eine sozial-medizinische Versorgung durch Gemeindeärzte gewährleisten sollte, zeichnet Margarete Grandner den Versuch der Durchsetzung aus legislativer Sicht nach. Dieser war gekennzeichnet von Kompetenzstreitigkeiten und Interessenskonflikten, die aufgrund der Kostenfrage letztlich ein Scheitern bedingten. Normsetzung ist also nicht gleichbedeutend mit Normdurchsetzung – es handelt sich um zwei verschiedene Prozesse, die beide als eine Machtfrage resultieren. Vor allem, wenn normative Quellen den Ausgangspunkt für Forschungen bilden, wird deren unterschiedliche Reichweite auf verschiedenen hierarchischen Ebenen gerne übersehen. Angesprochen ist in den genannten Beiträgen auch der Aspekt der Verbreitung und der – meist nur äußerst arbeitsaufwändig erschließbaren – Normgeltung in der Verwaltungspraxis. Hier schließt der Beitrag von Anton Tantner zur 1770/1771 vorgenommenen „Seelenkonskription“ in der Habsburgermonarchie an: Im Kontext der amtlich verfügten flächendeckenden Hausnummerierung traten ungeahnte Schwierigkeiten in der Durchführung auf: Das Phänomen beweglicher Häuser war in den obrigkeitlichen Klassifizierungsvorgaben nicht vorgesehen – neue Instruktionen daher vonnöten.
Normsetzungen und Rechtssysteme sind weiters eng mit einer Politik der Ungleich-Behandlung verbunden. Aus historischer Perspektive ist vor allem an die geschlechtsspezifisch determinierte Vorenthaltung von bestimmten Rechten zu denken sowie an Beschränkungen für bestimmte Gruppen. Auf diese Weise werden Partizipation und Integration auf verschiedenen Ebenen verhindert oder zumindest maßgeblich erschwert. Birgitta Bader-Zaar macht in ihrem Forumsbeitrag die Tragweite eines geminderten Rechtsstatus am Beispiel von chinesischen und japanischen Einwanderern im 19. Jahrhundert deutlich. Die vor dem U. S. Supreme Court geführten Gerichtsverfahren dokumentieren die Begrenzungen sozio-kultureller wie ökonomischer Handlungsspielräume für jene, die als „Fremde“ definiert werden. Sichtbar werden aber auch Möglichkeiten der Umgehung – ein nicht zu unterschätzendes Element der Praxis-Seite von Recht und Gesetz. Die Problematik, die sich ergibt, wenn gesellschaftliche Ausschließungstendenzen in Forschungszusammenhängen fortgeschrieben werden und damit den Blick auf Interaktionen verstellen, macht Barbara Staudinger zum Thema. Methodenkritisch hinterfragt sie dabei normierende Konzepte wie „Randgruppen“, „Paria“ oder „Fremde“, mit denen Juden in Studien zur Frühen Neuzeit vielfach belegt wurden und werden.
Gegen vorschnelle gruppenspezifische Zuschreibungen wendet sich auch Barbara Krug-Richter in ihrem Beitrag zu frühneuzeitlicher Konfliktkultur im studentischen Milieu in Freiburg im Breisgau. Indem sie Formen, Elemente und ritualisierte Abläufe herausarbeitet, widerlegt sie einerseits tradierte Bilder des ungeregelten, formlosen „Aufeinanderschlagens“. Wie Zeugenaussagen erkennen lassen, wird zwischen „redlichem“ und „schelmischen“ Schlagen – vergleichbar heutigen Kategorien von Fairness – deutlich unterschieden. Andererseits kristallisieren sich neben spezifischen Konfliktfeldern auch gruppen- bzw. milieuübergreifende Wahrnehmungs- und Handlungsmuster heraus.
Vermittlungsprozesse sozialer Normen und deren Gebrauch in konkreten alltagsweltlichen Kontexten zeigt der Beitrag von Gudrun Hopf, Angelika Klampfl und Margareth Lanzinger. Unterschiedlich stellt sich die Frage nach „Normalität“ in lebensgeschichtlichen Erzählungen von Jugendlichen der 1990er Jahre, in Entmündigungsakten und ärztlichen Gutachten im Kontext geistiger Behinderung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sowie in Zusammenhang von Vereinbarungen für Witwer- bzw. Witwenschaft im 18. Jahrhundert: als Projektion von Normalität, als Konstruktion von Normalität und als implizite, erst durch serielle Quellenauswertungen erkennbare geschlechtsspezifische Normalität.
Fazit: Nicht alle, die am sozialen Leben Teil haben, teilen auch „einen einzigen Satz normativer Erwartungen“. Kompromisse zwischen Normen und Praktiken müssen daher immer wieder neu hergestellt werden, und zwar nicht nur solche „zwischen subjektiv erwünschtem und sozial gefordertem Verhalten“, sondern auch solche zwischen rivalisierenden Normensystemen, die parallel und häufig auf verschiedenen Ebenen existieren. Herrschaftliche und dörfliche Normen konnten beispielsweise in Widerstreit geraten oder unterschiedliche Maßstäbe setzen.
Die Beiträge dieses Heftes machen insgesamt deutlich, dass es nicht um einen Gegensatz zwischen Normen und Praktiken geht, und ebenso wenig um eine Gegenüberstellung von Akzeptanz und Ablehnung oder von Entsprechung und Widerspruch. Dichotomisierungen dieser Art wären allzu simplifizierend, um gesellschaftliche Zusammenhänge erfassen zu können. Vielmehr sind wir in der Regel „mit einem komplexen Netzwerk von Akzeptanzen, Missachtungen, Kompromissen, gegenseitigen Beeinflussungen, Korrelationen und Diskussionen konfrontiert. […] Es geht […] um verschiedene Arten, Ebenen und Stufen von Aneignung und Disziplinierung, bestimmt von unterschiedlichen Determinanten und deren ‚Einbettung in spezifische Praktiken, die sie hervorbringen‘.“Zu unterscheiden ist dabei auch, ob Normen in lebensweltnahen Kontexten entstehen oder ob sie von außen hineingetragen werden bzw. inwieweit sie in diesem Fall mit dem Selbstverständnis, mit „internen“ Logiken und Konzepten vereinbar sind.
Aus der Fülle möglicher und weiterführender Themen sei hier noch auf Fragen der Zirkularität von Rechtsnormen verwiesen, wenn etwa von „unten“ herangetragene Supplikationen wiederum in die obrigkeitliche Gesetzgebung einfließen. Auch das sich mit zunehmender zeitlicher Distanz zu ihrer Entstehung verändernde Verständnis bestimmter Normen konstituiert ein weiteres wichtiges Themenfeld. Allgemein bietet der Gesamtkomplex von Normierung, von Möglichkeiten, Grenzen und konkreten Umständen ihrer Umsetzung sowie die Frage, was überhaupt als „normal“ wahrgenommen wird, ein vielfältig zu bearbeitendes Feld für künftige Forschungen.
Interdisziplinäre Zugänge scheinen uns besonders wichtig – es bleibt also trotz vieler bereits erzielter Ergebnisse noch einiges zu tun. Luther hat nur allzu recht mit seiner in einem Brief an den Landgrafen Philipp von Hessen geäußerten Einschätzung: „Es ist fur war gesetz machen ein gros, ferlich, weitleufftig ding.“
Margareth Lanzinger und Martin Scheutz
Barbara Staudinger
Jews as a „Pariah People“ or „Marginal Group“? Comments on Models for Portraying Christian-Jewish Relations in the Early Modern Period
Growing academic interest in historical social norms has broadened the trajectory of historians‘ research to include those persons and groups who were unwilling or unable to comply with the explicit and implicit rules of the societies in which they lived. Societies‘ reactions to these „marginal groups“ were manifested in stereotypes and forms of stigmatization, which served to define both „norms and „deviance“ from those norms. Taking its lead from studies of medieval urban history, current research classifies adiverse array of social groups, outsiders and minorities as a given society’s „marginal groups“ – including Jews who, however, because of their religious and cultural independence, were accorded their own special status. The inclusion of Jews among those groups at the margins of society has become the object of much criticism lately, in part due to recent findings concerning Christian-Jewish coexistence. Earlier attempts to describe the relationship between Jews and non-Jewish society make use of conceptions such as Max Weber’s „pariah people“ or Georg Simmel’s concept of the „strange“, both of which the present study juxtaposes with the idea of marginal groups. This critical comparison of these concepts‘ soundness – set in the context of the early modern period – is meant to support a more differentiated way of viewing the status of Jews in Christian society.
Barbara Krug-Richter
Of Daggers, Cloaks and Masculinity. Aspects of the Culture of Conflict Among Students in Early Modern Freiburg im Breisgau
This contribution analyses ways in which conflicts were carried out during the 16th and 17th centuries, taking as its example students of the University of Freiburg im Breisgau. The words „daggers, cloaks and masculinity“ in the title make reference to central elements of early modern student culture: the „dagger“ refers to the role played by cutting and thrusting weapons in the academic milieu of the 16th and early 17th centuries, the „cloak“ to sartorial status symbols that took on their own individual – even symbolic – significance parallel to the establishment of the fencing art within the student culture of conflict. Contemporary ideas of „masculinity“, on the other hand, serve as a backdrop against which students‘ conflict behavior can be interpreted in its various contexts. The analysis of how conflicts were carried out and regulated, in particular, shows itself to be a fruitful approach to understanding the complex relationships between norm and practice in early modern society by way of examples. The belief – still commonly held today – that the numerous armed fights between students prior to the advent of the formalized duel were largely devoid of both rules and form, does not hold up under closer examination. While warrior virtues such as the willingness to defend oneself, preparedness for battle, courage and valor were certainly held in high regard by young men in particular, most of the conflicts among students – or between students and journeymen (the classic opposing group) – were by no means free of rules. Contemporary ideas of fairness and honor subjected even the student conflicts to an informal system of – overwhelmingly binding – norms. Although the students‘ culture of conflict was based on generally applicable conceptions of masculinity, it was also tied to youth-culture-specific practices and value systems.
Peter Becker
From Demonization to Normalization? Reflections on the Representation of Criminals during the 19th Century
Inspired by the writings of Michel Foucault and Jürgen Link, this chapter explores the criminological discourse of the „long“ 19th century from a new perspective. The changing representations of criminals in the criminological discourse are understood to be part of a wider debate on the problems of integration of subjects into state and society. Strategies of disciplining deviant subjects are based on a continuity between law-abiding citizens and criminals and, at the same time, on a discontinuity on the moral-ethical level of the attitude towards life (Gesinnung). The new discursive formation at the end of the century inverted this configuration. The degenerated criminal was clearly differentiated from the „normal“ citizen – his moral exculpation opened, however, the way for more far reaching, eugenic forms of exclusion. Is thus disciplining and normalization the „lesser“ evil in a society’s confrontation with its others?
Margarete Grandner
Health Policy in Austria during the 19th Century
Exploring Austrian legislation in the 19th century which aimed at securing medical care for the lower classes of the population this essay attempts to show that the efficiency of legal norms is as precarious in modern times as it was in the early modern era. The first legislative step was the Imperial Sanitation Law of 1870. Besides the organization of public health this code intended to instal communal doctors throughout the realm. Due to financial problems this project foundered. The next step was the introduction of obligatory sickness insurance for workers in 1888. Although this regulation was not a health measure in the first place it eventually replaced the plan of public medical care. As a major but unintended consequence medical doctors were able to improve their social standing by their indispensability within social insurance. This is demonstrated by the introduction of „Physicians‘ Chambers“ in 1892 as an instrument to get doctor’s interests accepted.