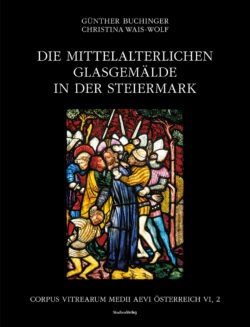Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 8. Jg., Heft 3, 1997
Geschichte als wissenschaftliche Forschungund jede Entdeckung verstört mehr oder weniger die allgemein
üblichen Anschauungen.
Émile Durkheim
Auf den ersten Blick mag die Tatsache banal erscheinen, daß sich Wissenschaft auf ganz unterschiedliche Arten betreiben läßt: nach den Modellen schulischer Lehre, weitabgewandter Gelehrsamkeit, moralisch-politischer Prophetie, nach Art philosophischer Theorie, positiv(istisch)er Empirie, staatsbürokratischer Technokratieberatung, als Rechtfertigung diverser wirtschaftlicher, politischer, religiöser, nationalstaatlicher usw. Interessen, als Grenzziehung zwischen akademischen Disziplinen, als universitäre Verwaltungsarbeit, öffentlich-mondäne Medienintellektualität oder als Berufskarriere usw. Wahrer und daher weniger banal ist sicherlich die Annahme, daß jede Tätigkeit, die sich offiziell mehr oder minder als Wissenschaft behaupten kann, auf all diese möglichen Referenzen gleichzeitig Bezug nimmt (auf jene stärker, auf diese schwächer, auf die eine eher positiv, auf die andere eher negativ) und daß sie ihre wissenschaftliche Identität durch ihre partikulare Position in der Struktur dieses Systems von Referenzen erhält – beziehungsweise, um Bachelards Konzept des epistemologischen Profils abzuwandeln, durch ihr wissenschaftliches Profil.
Ein Element dieses Systems unterscheidet sich dabei strukturell von allen anderen. Es gibt ein Modell, an dem sich Wissenschaft ausrichten läßt, das nicht auf die Rationalität anderer Bereiche (der Politik zum Beispiel oder des Journalismus, des Akademismus, der Literatur, der Verwaltungsbürokratie, des Nationalstaates, der Wirtschaft usw.) rekurriert, sondern eine wissenschaftsspezifische Rationalität erfordert und deren Genese ermöglicht: Je stärker und positiver sich eine Tätigkeit an der Referenz der wissenschaftlichen Forschung orientiert (die weder Grundlagenforschung noch angewandte Forschung ist), je mehr sie sich also für eine Wissenschaft vor allem als Forschung und, gleichzeitig, gerade nicht als Politik, Journalismus, Literatur, Staatsräson usw. einsetzt, umso mehr verwirklicht sie eine eigene Logik, die nicht auf andere soziale/historische Logiken reduziert werden kann, und umso mehr gelingt es ihr, etwas zu vollbringen, das keiner anderen Tätigkeit möglich ist.
Die Rationalität wissenschaftlicher Forschung rückt das spezialisierte Verstehen/Erklären, oder besser, die Spezialisierung von Verstehen/Erklären ins Zentrum allen Bemühens. Entdeckung und Innovation werden zum Einsatz, zur institutionellen Seltenheit von Wissenschaft, wenn es um die Maximierung der Berichtigung von Erkenntnis geht. Das Fragen "Warum?" kommt im Prinzip nie zur Ruhe, vor ihm ist nichts sicher, kein Wert und keine Tugend, kein Gefühl, keine Intuition und kein Glaube, keine Gewißheit und kein Wissen. Diesen werden durch die spezifische Spezialisierung Richtung, Gewichtung und Grenzen auferlegt, nicht umgekehrt; abgeleugnet oder verdrängt jedoch werden sie nicht. Es gibt keine politischen oder, allgemeiner, moralischen Grenzen des Fragens: Nichts ist so schlecht, daß es nicht mehr verstanden werden dürfte, nichts so gut, daß es nicht mehr erklärt werden müßte.
Je mehr Wissenschaft als Forschung betrieben wird, umso mehr existiert sie im Zusammenhang aller Bereiche einer Gesellschaft als relativ autonomer Bereich.
Das vorliegende Heft der ÖZG zeigt auf, zu welchen arbeitspraktischen Konsequenzen der Einsatz für eine Wissenschaft primär als Forschung führen kann und führt: Es versammelt Artikel von Autoren, deren Arbeiten eine äußerst vielfältige, kollektive Wissenschaftsunternehmung seit langem wesentlich mitprägen, bei der dieser Einsatz mit seltener Systematik verwirklicht wird. Und wenn es hier wohl nicht zu vermeiden ist, einen griffigen Bezugspunkt für diese Unternehmung anzuführen, so bieten sich am ehesten die von Pierre Bourdieu herausgegebenen und geleiteten Actes de la recherche en sciences sociales an, obwohl sich die Produktivität des Forschungszusammenhanges beileibe nicht in der Herstellung dieser Zeitschrift erschöpft und deren Präsentation (die im übrigen für deutschsprachige Leserinnen und Leser noch aussteht) nicht Thema dieses Heftes ist.
Die Actes de la recherche haben von ihrem ersten Heft 1975 an als Versuchslabor gedient, um ein Forschungsprogramm zu konkretisieren, zu berichtigen und weiterzuentwickeln, das Pierre Bourdieu zuvor in einigen Arbeiten entworfen hatte (der kurze Hinweis auf die Konzepte Feld und Habitus muß hier genügen): Innovation von Erkenntnis als Prinzip. Die Artikel, die dort bis heute erschienen sind, weisen untereinander eine hohe Kohärenz auf, was weniger thematischen, theoretischen oder technischen Vorgaben geschuldet ist, als dem Umstand, daß die Zeitschrift wesentlich von den Beiträgen eines mehr oder weniger festen Kerns von Mitarbeitern bestimmt ist, die durch einen starken Konsens über den Sinn ihres gemeinsamen Einsatzes für eine Wissenschaft primär als reflexive/experimentelle Forschung verbunden sind. Im Gegensatz zur Rigidität eines (sprachlichen, theoretischen, methodologischen, moralischen usw.) Reglements, das oft den Zusammenhalt einer intellektuellen Schule begründet, scheint dieser Konsens Individualismus zu begünstigen, sogar zu erfordern: Gerade indem sie die behandelten Gegenstände maximal diversifiziert, indem sie etablierte Vorgangsweisen und eigene Forschungsergebnisse systematisch zu überschreiten sucht, gelingt dieser Zusammenarbeit auf Dauer die Akkumulation kollektiver Errungenschaften. Zwei Beispiele für solch ein zugleich diskontinuierliches und kontinuierliches Verhältnis zur eigenen Tradition, für eine Forschungsarbeit als kumulativen Bruch, bieten die Artikel von Christophe Charle und Viktor Karady.
Der Titel Sozialwissenschaftliche Forschungsakte/n, so läßt sich Actes de la recherche en sciences sociales ungefähr übersetzen, impliziert neben diesen positiven eine ganze Reihe an negativen Bezügen. Nationale und akademisch-disziplinäre Abgrenzungen zum Beispiel, zwei der zähesten Erkenntnishindernisse, werden nicht genannt, wie auch keine andere jener vorgegebenen Grenzen, die sich allen möglichen institutionellen Logiken verdanken, aber nur nicht der Rationalität wissenschaftlicher Forschung: Statt als selbstverständliche Gegebenheiten der Erkenntnis Grenzen zu setzen, werden sie zum Gegenstand der Erkenntnis – das ruhelose Warum als Prinzip. Für diese Haltung stehen exemplarisch die Artikel von Louis Pinto und Rémi Lenoir, in denen die etablierten Beziehungen zwischen den Disziplinen (genauso wie zum Beispiel die sakrosankte Trennung von Theorie und Empirie) befragt werden, statt unbefragt im Hintergrund alle Fragen zu bestimmen.
Diese Bemerkungen mögen als einleitende Skizze genügen, zumal Gerard Mauger und Louis Pinto im ersten Artikel den Einsatz für eine Wissenschaft als reflexive/experimentelle Forschung prägnant auf den Punkt bringen und dabei, notwendigerweise, die zentralen Fragen von Wissenschaftsvermittlung und Wissenschaftspolitik miteinbeziehen.
Pierre Bourdieu insistiert nun schon seit fast dreißig Jahren darauf, daß der Erkenntnisfortschritt keineswegs Folge allein der wissenschaftlich-fachlichen Debatten sei, sondern den Kampf um die Instituierung der historischen/sozialen Bedingungen der Möglichkeit solcher Debatten zur Voraussetzung habe, den Kampf um die Autonomisierung des wissenschaftlichen Feldes. Zu dieser "Realpolitik der Vernunft" soll auch das vorliegende Heft beitragen – und sei es nur, indem es öffentlich zu einem Zeitpunkt für eine stärkere Autonomisierung der Geschichte als wissenschaftlicher Forschung plädiert, in dem Wissenschaft verstärkt auf eine nur schlecht als "Praxisrelevanz" camouflierte Selbstaufgabe verpflichtet werden soll.
Alexander Mejstrik, Wien
Inhalte
Gérard Mauger/Louis Pinto
Lire les sciences sociales
Christophe Charle
Das Amtsbürgertum im Frankreich des 19. Jahrhunderts
Viktor Karady
Das Judentum als Bildungsmacht in der Moderne. Forschungsansätze zur relativen Überschulung in Mitteleuropa
Louis Pinto
Die Verneinung des Ursprungs. Hermann Cohen: von der Soziologie zur Transzendentalphilosophie
Rémi Lenoir
Die Erfindung der Demographie und die Bildung des Staates